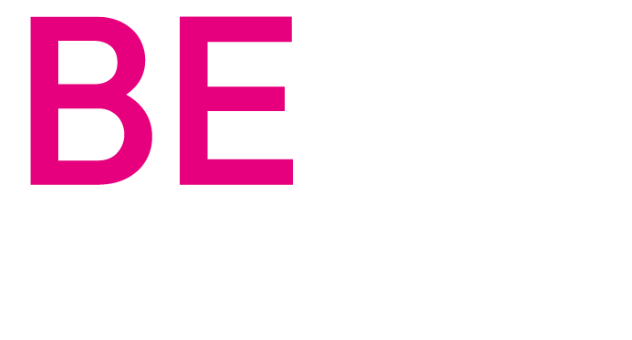BENE: Lieber Herr Forster, vielen Dank erst mal, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. 30 Minuten haben wir für das Gespräch zur Verfügung. Sie haben offenbar einen sehr engen Terminplan. Zeitdruck, den man beim Pilgern nicht hat.
Forster: Ein Kumpel von mir ist ein Jahr zuvor den Jakobsweg nach Santiago de Compostela gelaufen und hat davon geschwärmt. Ich hielt das für eine coole Idee. Zu dem Zeitpunkt war ich nicht so zufrieden mit mir und meinem Leben. Ich habe das dann geplant und bin losgelaufen. Das Spannende ist ja, dass man für den Jakobsweg viel mehr Zeit braucht als nur sechs Wochen. Er beginnt schon ein paar Monate früher. Man muss sich den Zeitraum freihalten, viel lesen, die Ausrüstung leihen. Und man muss sich auf die körperlichen Strapazen vorbereiten.
Sechs Wochen waren Sie auf dem Jakobsweg unterwegs. Gab es ein Erlebnis, das Sie besonders geprägt hat?
Forster: Es gab in dem Sinne kein einschneidendes Erlebnis. Ich bin dorthin gefahren, um rumzulaufen und nachzugrübeln. Man geht einfach jeden Tag sieben, acht Stunden spazieren. Wichtig ist nur, dass man genug Wasser dabeihat, sich ein Brötchen geschmiert und überlegt hat, bis wohin man laufen und wo man schlafen möchte. Die Dinge, die passieren, die passieren langsam, nach einer Weile.
Weil man sich erst an die neue Umgebung gewöhnen muss?
Forster: Man braucht Zeit, um überhaupt reinzukommen. Es gibt einen alten Pilgerspruch, der besagt, der Jakobsweg sei wie ein ganzes Leben in sechs Wochen. Zu Beginn weiß man nicht, was los ist. Später verfällt man in einen sportlichen Ehrgeiz und will alles besonders gut machen. Dann ist man irgendwann voll drin, und gegen Ende findet man es schade, dass alles bald vorbei ist. Vielleicht ist das Pilgern eine Analogie zum Leben. Ich pilgere immer noch, um abzuschalten. Inzwischen war ich insgesamt viermal unterwegs.
In dem Lied „194 Länder“ singen Sie: „Camino Francés war die Rettung. Konnt' mich auf spanischen Pfaden entdecken.“ Was war nach dem Pilgern anders als vorher?
Forster: Zum einen habe ich seitdem einen Bart, den Schmuck des Pilgers. (lacht) Zum anderen habe ich mir auf dem Weg vorgenommen, nicht nur hobbymäßig Musik zu machen,
sondern ernsthaft an einem Album zu arbeiten. Es zu schreiben, aufzunehmen und fertigzustellen.
Warum haben Sie das nicht schon vor der Bewältigung des Jakobsweges gemacht?
Forster: Wenn man nicht gerade Musiklehrer oder Orchestermusiker werden möchte, sondern die Art von Sänger, dessen Lieder im Radio laufen und der Konzerte vor Tausenden Menschen gibt, dann ist das eher eine Fantasie als ein realer Berufswunsch. Vor allem wenn man aus so einem kleinen Ort kommt wie ich, ist es nicht realistisch, dass das mit der großen Karriere klappt. Um das dennoch einfach mal zu versuchen, habe ich den Jakobsweg gebraucht. Erst danach habe ich mich getraut, das wirklich konkret anzugehen.
Auf Ihrem aktuellen Album geben Sie viel von sich preis. Sie singen über Beziehungen, über Ihre Familie. Ein Lied heißt „Genau wie du“. In diesem beschreiben Sie Ähnlich-keiten zwischen Ihnen und Ihrem Vater. Fällt es Ihnen schwer, so etwas Persönliches zu thematisieren?
Forster: Ich kann gar nicht anders. Ein Lied ist für mich nur dann gut, wenn es etwas Echtes beschreibt: ein echtes Gefühl, eine echte Geschichte. Ich bin kein Romanautor, ich kann mir das nicht ausdenken. Alles, was ich schreibe, passiert mir auch. Ich habe das Lied vor der Veröffentlichung meinem Vater geschickt. Er hat mir gesagt, dass er genauso fühlt wie ich.
Ich habe während der Produktion des Albums viel mit meiner Familie gesprochen. Auch über Sachen, die man normalerweise nicht unbedingt diskutiert hätte.
In dem Lied heißt es: „Wir waren zu dritt zu Haus', und ohne dich hat was gefehlt. Du in der großen Welt und wir auf uns gestellt. Wir haben's geschafft, so ging's auch. Die Welt wird kleiner, jetzt weiß ich's auch.“ Es geht um Ihren Vater, der Ihre Mutter, Sie und Ihre Schwester verließ, als Sie noch klein waren. Kann man so einen Weggang besser verstehen, wenn man älter wird?
Forster: Ja, schon. Das Coole an Liedern ist ja, man hat den Text, aber man hat auch eine Ebene mehr, nämlich die Musik. Manchmal kann man dann in einem Lied etwas ausdrücken, was man in einem Gespräch gar nicht sagen kann, weil eine Ebene fehlt. Wenn man das „Vaterunser“ singt, ist es ja auch anders, als wenn man es sich vorsagt. Deshalb brauche ich oft Lieder, um Dinge zu sagen oder mir bewusst zu machen.
Sie erwähnten gerade das „Vaterunser“: Stimmt es, dass Sie als Kind Pfarrer werden wollten?
Forster: Ich habe eine polnische Mutter, meine Schwester und ich wurden katholisch erzogen. Damals mussten wir sonntags immer zur Kirche. Als ich acht war, war in meinem Universum die Möglichkeit überhaupt nicht gegeben, dass das irgendwann nicht mehr so ist. Ich habe mich in der Kirche häufig umgeguckt und dabei gesehen, dass all meinen Freunden langweilig war. Der Einzige, der Spaß hatte, war der Pfarrer. Dann habe ich gedacht, werde ich halt Pfarrer. Irgendwann habe ich aber gecheckt, dass es noch Alternativen gibt. (lacht)
Sie sagten, dass Sie von Ihrer Mutter katholisch erzogen wurden. Hat Sie das in irgendeiner Form geprägt?
Forster: Wenn man katholisch aufgewachsen ist, gehört man irgendwie automatisch dazu. Ich gehe jetzt nicht mehr in die Kirche, außer wenn meine Mutter oder meine Tante mich dazu überreden. (lacht) Dann werde ich sofort wieder der Achtjährige, dem ein bisschen langweilig ist. Ich würde mich zwar nicht im klassischen Sinne als gläubig bezeichnen. Dennoch finde ich das alles nicht blöd! Ich bin ein wenig neidisch auf Menschen, die uneingeschränkt glauben können. Das ist ein schöner Anker, ein schöner Hafen. Die Menschen, die aufrichtig glauben, empfinde ich als angenehm und nicht unzufrieden. Ich selbst bin weit weg von der Katholischen Kirche, obwohl ich jemand bin, der sich viele Gedanken macht, der offen und interessiert ist. Aber irgendwie hat mich die Katholische Kirche ein bisschen verloren.
Das klingt so, als würden Sie das bedauern.
Forster: Auch wenn die Katholische Kirche in ihrer langen Historie für richtig viel Mist steht, steht sie ja grundsätzlich für etwas Gutes. Es ist ja meistens nicht der Kern oder der Grundgedanke dieser Institution, der einen auf Distanz hält. Es sind eher die menschlichen Versäumnisse, die es einem so schwer machen, dem Ganzen zu folgen.
Das Interview führte Kathrin Brüggemann.