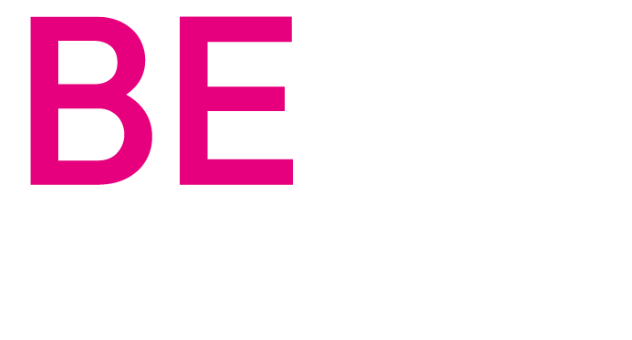Wohin steuert das Bistum Essen?
BENE im Gespräch mit dem Generalvikar des Bistums Essen, Klaus Pfeffer
Kirche und PEP: Was bedeutet das eigentlich?
Externer Inhalt
Dieser Inhalt von
youtube-nocookie.com
wird aus Datenschutzgründen erst nach expliziter Zustimmung angezeigt.

Der Pfarreientwicklungsprozess "PEP" ist ein ehrgeiziges Unterfangen, die katholische Kirche im Bistum Essen für die Zukunft zu rüsten: Er verlangt vor allem den Verantwortlichen in den Gemeinden viel ab. Kann "PEP" gutgehen? Die Zeit läuft, die Anspannung steigt und die Fragen häufen sich. Der zuständige Generalvikar Klaus Pfeffer glaubt an Verständigung und plädiert für Mut und Weitsicht. BENE hat mit ihm gesprochen.
BENE: Vor etwas mehr als zehn Jahren hat das Bistum Essen alles auf den Prüfstand gestellt, Pfarreien zusammengelegt, Kirchen geschlossen. Warum ist das jetzt schon wieder nötig?
Klaus Pfeffer: Damals war das Bistum Essen in eine dramatischewirtschaftliche Situation geraten. Sehr kurzfristig musste gehandelt werden, um die Gefahr einer Zahlungsunfähigkeit abzuwenden. Eine solche Situation darf es nicht wieder geben. In den vergangenen Jahren hat vor allem die gute wirtschaftliche Lage dafür gesorgt, dass die Einnahmen durch die Kirchensteuer einigermaßen stabil geblieben sind. Das wird aber so nicht bleiben. Unsere Ausgaben steigen in allen Bereichen weiter – vor allem die Personalkosten. Hinzu kommt die große Zahl an Gebäuden, deren Erhalt viel Geld benötigt.
BENE: Aber es ist doch immer wieder von steigenden Kirchensteuereinnahmen die Rede – manchmal sogar in sehr großer Höhe?
Pfeffer: Leider gilt das für uns nur begrenzt. Die wirtschaftliche Lage ist in Teilen des Ruhrgebiets nicht so gut wie in anderen Bundesländern. Deshalb profitieren wir nicht so stark davon. Hinzu kommt: Wir sind ein junges Bistum und verfügen über keine Reichtümer aus der Vergangenheit. Deshalb sind wir fast ausschließlich von den Kirchensteuern abhängig.
BENE: Man könnte das Ruhrbistum doch auch einfach wieder an seine Mutterbistümer Köln, Paderborn und Münster zurückgeben ...
Pfeffer: Nein, das wäre auch gerade für das Ruhrgebiet ein schlechtes Signal. Außerdem haben wir in den 60 Jahren unseres Bestehens inzwischen ein starkes „Wir“-Gefühl entwickelt – warum sollten wir uns also auseinander reißen lassen? Diejenigen, die einer Auflösung des Bistums das Wort reden, träumen davon, dann vor Ort vom angeblichen „Reichtum“ der Nachbarbistümer zu profitieren – als könnte dann alles so bleiben, wie es ist. Das ist allerdings eine Illusion. Viele Verpflichtungen für Personal, Gebäudeunterhalt blieben ja auch bei einer Bistumsauflösung erhalten. Und auch in den Nachbarbistümern gibt es längst die gleichen Herausforderungen wie bei uns. Mag sein, dass ein wenig Zeit gewonnen würde – aber letztlich wäre es nur eine Verschiebung der Prozesse. Unabhängig davon bezweifle ich, dass der Vatikan überhaupt ein Interesse hätte, mit dem Land Nordrhein-Westfalen über eine Auflösung des Bistums zu verhandeln. Angesichts der komplexen Staat-Kirche-Regelungen ist das sehr unwahrscheinlich. Die finanzielle Überlebensfähigkeit einer Diözesewäre für Rom kein ausschlaggebender Grund, sich mit einer solchen Frage zu beschäftigen. Das flächenmäßig etwas kleinere Italien zählt sogar mehr als 220 Diözesen. Dagegen erscheint Deutschland mit seinen 27 (Erz-)Diözesen schon wie eine Sparversion.
BENE: Es wird für so vieles Geld ausgegeben. Die Kirche ist doch so reich. Warum müssen jetzt wieder die Pfarreien und Gemeinden bluten?
Pfeffer: Keine Frage: Die Kirche in Deutschland ist – gerade im Vergleich mit der weltweiten Kirche – immer noch sehr reich. Aber wir lagern das Geld ja nicht in Kellerräumen, sondern setzen es für viele Aufgaben ein: Von unseren Kindertagesstätten über Einrichtungen der Caritas, unseren Schulen, Familien- und Bildungseinrichtungen, den seelsorglichen Diensten für alle Generationen bis hin zu unseren Kirchengemeinden. Sparen müssen wir derzeit in allen Bereichen – es sind keineswegs nur unsere Gemeinden.
BENE: Was entgegnen Sie denen, die den Veränderungswillen und die Ernsthaftigkeit des Entwicklungsprozesses in Frage stellen, die zum Beispiel sagen: Das ist doch eh’ schon alles eine abgemachte Sache?
Pfeffer: Viele glauben, der Bischof und seine Mitarbeitenden hätten insgeheim längst Vorentscheidungen getroffen. Da ist die Rede von einem „Masterplan“, der in der Schublade des Bischofshauses liege und der festlegt, welche Kirchen es im Jahre 2030 noch geben soll – und welche nicht mehr. Ich kann versichern: Es gibt diesen Plan nicht. Wie sollte das auch gehen? Die Menschen in den Pfarreien kennen ihre Situation viel besser und können eher beurteilen, was sinnvoll ist. Natürlich beraten und begleiten wir die Prozesse, damit der Bischof am Ende jede Entscheidung mittragen kann – aber die Experten sind vor Ort und müssen maßgeblich selbst den Weg in die Zukunft Ihrer Pfarreien und Gemeinden finden.
BENE: Aber genau diese Experten vor Ort sind mit harschen Reaktionen und großem Unmut konfrontiert. Wie stärken Sie die?
Pfeffer: Alle, die sich in den Pfarreientwicklungsprozessen engagieren, stellen sich einer gewaltigen Herausforderung. Sie sehen, dass wir die Realitäten nicht verleugnen können und in unserer Kirche Veränderungen herbeiführen müssen, die auch weh tun. Es kann nicht alles bleiben, wie es ist. Wer sich dieser Herausforderung stellt und Verantwortung übernimmt, hat alle Unterstützung verdient. Ihnen stärke ich den Rücken und weise unangemessene persönliche Angriffe zurück. Mich erschreckt ohnehin der Stil und Tonfall in manchen innerkirchlichen Auseinandersetzungen. Wir brauchen das grundsätzliche Vertrauen, das aus unserem Christsein erwächst und mit dem wir jeder und jedem anderen unterstellen, gute Absichten für die Zukunft der Kirche zu verfolgen. Wenn wir uns gegenseitig mit Vorwürfen überschütten und einander persönlich verletzen, tragen wir nicht zur Glaubwürdigkeit des Christentums bei.
BENE: Die Gläubigen hören immer nur: Hier und dort muss gespart werden. Wo spart denn das Bistum selbst?
Pfeffer: „Das Bistum“ sind wir als katholische Kirche in unserer Region gemeinsam – und deshalb sparen wir auch gemeinsam. Dabei stehen alle Bereiche auf dem Prüfstand. Es trifft nicht nur die Pfarreien. Auch die Caritas, der Kita-Zweckverband, die Familienbildungsstätten und Bildungswerke und auch das Bischöfliche Generalvikariat müssen mit weniger finanziellen Mitteln die künftige Arbeit gestalten. Wir schauen dabei auch über den diözesanen Tellerrand. So haben wir bereits vor wenigen Jahren das Priesterseminar in Bochum aufgegeben und die Ausbildung des Priesternachwuchses gemeinsam mit anderen Bistümern nach Münster verlegt.
BENE: Warum glauben Sie an den Pfarreientwicklungsprozess und wo sehen Sie das Bistum Essen und seine Katholiken im Jahr 2030?
Pfeffer: Wir sind seit 2012 in einem intensiven Gesprächsprozess, bei dem es gerade nicht zuerst um finanzielle Fragen geht. Die Frage ist doch: Warum sind wir eigentlich in einer so schwierigen Situation? Die Menschen in unserer Gesellschaft haben sich in den letzten Jahrzehnten massiv verändert. Wer heute und in Zukunft Christ wird, macht das nur aus einer tiefen inneren Überzeugung heraus – aber kaum noch aus Gewohnheit. In unserer freiheitlichen und pluralen Gesellschaft gibt es unzählige Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten – auch im Blick auf Religion und Weltanschauung. Darum wird die Zahl der Kirchenmitglieder kleiner, niemand macht mehr „automatisch“ in einer Gemeinde mit. Darum müssen wir uns ernsthafte Fragen stellen: Welche Veränderungen sind nötig, damit wir für die Menschen unserer Zeit ansprechend bleiben? Was kommt in den nächsten Jahren auf unsere Gemeinden, Organisationen und Einrichtungen zu? Was brauchen wir noch in zehn oder zwanzig Jahren? Und was müssen wir komplett neu erfinden? Das sind brisante Fragen, zumal in unserer Kirche oft der Wunsch überwiegt, alles beim Alten belassen zu wollen. Aber ich erlebe auch viele Christen, die Lust auf Veränderung haben. Es gibt ja auch viel Unzufriedenheit – und deshalb ist diese Krisensituation eine Chance, mancherorts Kirche neu zu erfinden.
BENE: Wen kann die katholische Kirche überhaupt noch begeistern und mitreißen? Wo sehen Sie Potenzial von „Kirchenfernen“ und wie bekommen die (wieder) einen Zugang zu den christlichen Themen?
Pfeffer: Ich erlebe außerhalb unserer Kirchengrenzen durchaus ein großes Interesse an Fragen nach Sinn, nach Tiefgang, nach Werten und nach Religion. Leider haben wir als Kirche zu vielen derart interessierten Menschen den Anschluss verloren. Es fehlt an der geeigneten Ansprache, an den passenden Orten und Angeboten. Ich fürchte, wir hängen oft noch viel zu sehr an Formen, die von ihrer Sprache, ihrem Stil und ihrer gesamten Kultur gar nicht mehr zusammenpassen mit einer Mehrheit der Menschen unserer Zeit. Im Moment wagen wir deshalb einige Experimente und haben 20 Projekte auf den Weg gebracht, um unser Zukunftsbild umzusetzen, mit dem wir seit 2013 unsere Vision einer erneuerten Kirche beschreiben. Dabei machen wir gute Erfahrungen: Beispielsweise stoßen Segnungs-Gottesdienste für Neugeborene auf großen Zuspruch. Familien werden eingeladen, mit ihrem neugeborenen Kind einfach einen Segen zu empfangen – erstaunlich, wie viele Familien sich dadurch anrühren lassen. Oder mit Hilfe von sogenannten Pop-Kantoren versuchen wir, neue musikalische Akzente in unsere Gottesdienste zu bringen – mit ebenfalls hohem Zuspruch. Auf junge Paare, die heiraten wollen und sich dabei mit ihren Wünschen für eine kirchliche Hochzeit allein gelassen fühlen, gehen wir mit einem eigenen Team zu, um ihnen zur Seite zu stehen.
BENE: Ein Worst-Case-Szenario: In zwanzig Jahren ist die katholische Kirche nur noch eine Sekte, Gotteshäuser sind kaum noch da, Klöster stehen leer. Es gibt kaum noch katholische Priester, die ehrenamtlichen Helfer (vor allem Frauen) haben ihr aus Verzweiflung über mangelnde Glaubwürdigkeit und Konservatismus den Rücken gekehrt, der Gläubigen-Nachwuchs fehlt, weil die Jugend nicht mehr katholisch sozialisiert ist. Und jetzt Sie!
Pfeffer: Nein, diese düstere Perspektive habe ich nicht. Ich bin viel zu sehr überzeugt von dem, woran ich glaube. Jesus Christus ist mit seiner Botschaft so faszinierend und „packt“ im wahrsten Sinn des Wortes immer wieder Menschen – das wird auch in den kommenden Generationen so bleiben. Allerdings wird die Form, wie die Christen ihren Glauben leben, eine andere sein. Das war in den 2000 Jahren der Geschichte des Christentums übrigens nie anders.
Die Fragen stellte Jutta Laege
Klaus Pfeffer: Meine persönliche Vision von Kirche in der Zukunft

"Es wird zwar weniger Christen als heute geben, aber sie sind dafür entschieden und überzeugend. Sie strahlen aus, engagieren sich in der Gesellschaft, setzen sich für andere Menschen ein, tun viel Gutes. Sie treffen sich in kleinen Gemeinschaften dort, wo sie zusammen leben, aber auch an einigen sehr zentralen Orten. Das können „alte“ Kirchen sein, aber auch ganz neue Kirchen, die eine besondere geistliche Atmosphäre vermitteln. Dort werden attraktive Gottesdienste gefeiert und es gibt verschiedene Angebote kultureller, sozialer und geistlicher Art. Natürlich wird es Priester geben – wie auch immer sich das Amt in der Kirche bis dahin entwickelt. Daneben gibt es weitere hauptberuflich Mitarbeitende, aber in kleinerer Zahl – denn das Leben der Kirche wird von allen Gläubigen ganz selbstverständ- lich mitgestaltet und getragen. Wahrscheinlich wird die Trennung der Konfessionen dann überwunden sein; zumindest spielt sie dann keine entscheidende Rolle mehr, weil Vielfalt keine Angst bereitet, sondern auf dem Boden einer starken Verbundenheit im Glauben an Jesus Christus beruht.“